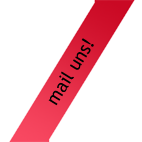Siehe auch: Aufruf des Vereins österreichischer Jurist_innen
Absender:
Wilfried Mayr, Josef Gary Fuchsbauer
Österreichische LehrerInnen Initiative
Pflasterweg 7
4643 Pettenbach – a@oeli-ug.at
An das
Austrian Standards Institut
z.H. DIin (FH) Dagmar Schermann, MSc
Heinestraße 38
1020 Wien
per Email: d.schermann@austrian-standards.at
Betrifft: Stellungnahme zum ÖNORM-Entwurf A 1080:2014-02-15 (Richtlinien für die Textgestaltung)
Sehr geehrte Frau DIin Schermann, sehr geehrte Damen und Herren!
Eine geschlechtergerechte Sprache ist neben zahlreichen anderen notwendigen Maßnahmen ein wesentliches Instrument zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Die Möglichkeit, zum aus Gleichstellungsperspektive wichtigen ÖNORM-Entwurf A-1080 eine Stellungnahme abzugeben ist daher zu begrüßen. Jedoch muss der intransparente und vor allem im technischen Sinn wenig benutzerInnenfreundliche Ablauf des Stellungnahmeverfahrens kritisiert werden. Aus demokratiepolitischen Gründen ist eine grundsätzliche Überarbeitung der Partizipationsmöglichkeiten bei der Entwicklung von Normen anzudenken.
Bevor auf die einzelnen Punkte des og. Entwurfs eingegangen wird, ist grundsätzlich anzumerken, dass der im Entwurf an mehreren Stellen erfolgte Vorschlag, die männliche Formulierung für die Bezeichnung aller Geschlechter als „allgemeingültige Form“ zu verwenden, abzulehnen ist. Die dadurch erfolgte – nicht neue, aber definitiv mit der modernen Realität nicht mehr konforme– Konstruktion von „männlich“ als Norm (und damit Gleichsetzung von Mann = Mensch) macht die Notwendigkeit einer tatsächlich geschlechtergerechten Sprache einmal mehr deutlich.
Ad) 7.2.2, B.1., B.3., B.5., B.9.:
Dem Textentwurf ist der Grundsatz zu entnehmen, dass eingeschlechtliche Angaben ein Grundmerkmal in der Grammatikstruktur unserer deutschen Sprache sind. Der Entwurf führt aus, dass „unsere Sprache seit jeher über die Möglichkeit verfügt, mit Hilfe eingeschlechtlicher Angaben beide Geschlechter anzusprechen“. Diese eingeschlechtlichen Formulierungen gelten dem Textentwurf zufolge für Frauen und Männer.
Sprache soll Realität abbilden und daher verständlich sein. Eine Sprache, die lediglich männliche Formulierungen verwendet, wenn es tatsächlich um Männer und Frauen geht, bildet weder die Realität ab, noch ist sie verständlich: zahlreiche sprachwissenschaftliche Studien belegen, dass Texte, die ausschließlich die männliche Sprachform verwenden, bei Rezipienten und Rezipientinnen eine kognitive Überrepräsentanz von Männern bei gleichzeitiger gedanklicher Nichteinbeziehung von Frauen erzeugen.Frauen werden daher eben nicht „mitgemeint“ und sprachwissenschaftliche Tests zeigen auch, dass es sich bei der männlichen Formulierung (Romanhelden) keinesfalls um eine „neutrale“ handelt. Sowohl die weiblichen als auch die männlichen Befragten nannten im Rahmen dieser Tests mehr weibliche Romanheldinnen, wenn die neutrale Form (zB. Romanfigur) oder beide Geschlechter in den Fragestellungen auftauchten, als wenn die männliche Form gebraucht wurde.(vgl. z.B. Journal of Psychology, 4/2004, Stahlberg/Sczesny, Psychologische Rundschau, 3/2001, Gygax/Gabriel/Sarrasin/Oakhill/Garnham, Gernerically intended, but specifically interpreted: When beauticians, musicians, and mechanics are all men, 2008).
Gerade aus Gründen der Verständlichkeit und der Präzision ist daher die Verwendung der rein männlichen Form abzulehnen, da diese keine allgemeine oder „neutrale“ Bedeutung hat. Dies kann auch nicht durch die Verwendung einer Generalklausel, wonach sich personenbezogene Ausdrücke in ihrer „allgemeinen Bedeutung“ (gemeint ist die männliche Form) auf Frauen und Männer gleichermaßen beziehen würden, hergestellt werden, wie unter 7.2.3. des Entwurfs empfohlen.
Ad) 7.2.1, 7.2.3.:
Die Verwendung des Binnen-I hat sich im Alltagssprachgebrauch als eine wesentliche Variante der Sichtbarmachung der weiblichen und männlichen Form etabliert. Aus grammatikalischen Gründen wäre das Argument des „Mitgemeint-Seins“ – wenn, dann – bei der ausschließlichen Verwendung der weiblichen Form insofern korrekt, als dass Nomen häufig in der weiblichen Pluralform auch die männliche beinhalten.
Die deutsche Sprache bietet daneben jedoch – gesprochen und verschriftlicht – eine weite Bandbreite an Alternativen, um geschlechtergerecht zu formulieren. Formulierungen mit Schrägstrich können mündlich beispielsweise mit einem „oder“ einem „und“ oder durch Setzen einer kurzen Sprechpause artikuliert werden. Die Praxis beweist, dass dies auch möglich ist.
Entgegen der Darstellung des Entwurfs unter B.2., wonach Nomen für Lebewesen „zusätzlich [zum grammatikalischen] ein natürliches Geschlecht“ haben, ist im Sinne eines zeitgemäßen Gleichstellungs- und Genderkonzepts, wonach es sich bei Geschlecht auch um gesellschaftliche, diskursive Praktiken und Zuschreibungen handelt und sich daher nicht nur auf jeweils ein biologisches Geschlecht reduzieren lässt, gerade auch auf jene Varianten zu verweisen, die diese Vielfalt auch sichtbar machen und auch beispielsweise transidente Menschen nicht ausschließen.
Als Beispiele haben sich hier in der Praxis etwa der „_“ sowie der „*“ etabliert, z.B. „Liebe Lehrer_innen“ oder „Liebe Lehrer*innen“.
Artikel 7 Abs 3 B-VG sieht vor, dass Amtsbezeichnungen, Titel, akademische Grade und Berufsbezeichnungen in jener Form verwendet werden können, die das Geschlecht des Amtsinhabers oder der Amtsinhaberin zum Ausdruck bringt. Werden entsprechende Abkürzungen lediglich in der männlichen Form verwendet, wie im vorliegenden Entwurf vorgesehen, wird nicht nur das Führen akademischer Titel durch Frauen sprachlich unsichtbar gemacht, sondern leidet aufgrund der unpräzisen Bezeichnung auch das Verständnis eines Textes darunter.
Ad) 7.2.6., B.4., B.5.:
Im Zusammenhang mit geschlechtersensibler Formulierung ist darauf zu verweisen, dass weibliche Sprachformen, obwohl der männlichen Form ja angeblich „allgemeine Bedeutung“ zukommt, ja durchaus allgegenwärtig verwendet werden – und zwar vor allem in jenen Konstellationen, wo es geschlechterstereotyp „passend“ erscheint, also beispielsweise „Kindergärtnerinnen“ oder „Putzfrauen“. Die jeweils verwendete Sprachform beeinflusst demnach die Vorstellungen über die beschriebene Person und ist daher – bei nicht durchgängig verwendeter geschlechtergerechter Formulierung – ein wesentlicher Faktor, um traditionelle Bilder über Frauen und Männer fest- und fortzuschreiben.
Denn Sprache bildet nicht nur de-facto-Realitäten ab, sondern prägt auch unser Bewusstsein und wirkt damit als ein Faktor der gesellschaftlichen Weiterentwicklung. Eine geschlechtergerechte Sprache impliziert demnach nicht nur die Existenz von mehr als dem männlichen Geschlecht (und kann dadurch – je nach Fallkonstellation – eventuell schon Reflektionen über Geschlechterverhältnisse auslösen), sondern trägt darüber hinaus die Botschaft in sich, dass Geschlechtergleichstellung ein gesellschaftspolitischer Wert ist. Neben der Vermeidung der Verwendung der rein männlichen Formulierung von Texten, ist das Sichtbarmachen von Frauen in der Sprache daher jedenfalls ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Geschlechtergleichstellung.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass dies auch an mehreren Stellen rechtlich verankert ist. An oberster Stelle ist hier auf die Staatszielbestimmung in Art 7 Abs 2 B-VG zu verweisen, wonach sich Bund, Länder und Gemeinden zur tatsächlichen Gleichstellung von Mann und Frau bekennen. Sprache ist ein wesentliches Instrument der Geschlechtergleichstellung, dem, wie oben ausgeführt, nicht nur symbolische sondern auch bewusstseinsprägende und gestaltende Wirkung zukommt. Auch auf europäischer Eben gilt die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern nicht nur als wesentliches politisches Ziel der Europäischen Union sondern ist mittlerweile als „General Principle“ (grund)rechtlich verankert. In einer Empfehlung des Europarates zur Eliminierung von Sexismus in der Sprache wird dem auch auf dieser Ebene Rechnung getragen.[1]
Auf Grundlage der sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse, wonach sich potentielle BewerberInnen nicht von einem eingeschlechtlich formulierten Ausschreibungstext angesprochen fühlen, normieren daher Gleichbehandlungsgesetze sowohl für den Öffentlichen Dienst als auch für die Privatwirtschaft für Stellenausschreibungen dezidiert eine sprachliche Gleichbehandlung und damit Sichtbarmachung beider Geschlechter.[2] Ganz allgemein sei zudem auf diverse Gender Mainstreaming Projekte der österreichischen Verwaltung, was nicht zuletzt in der verfassungsrechtlichen Verankerung des Gender Budgetings seinen Ausdruck findet, verwiesen, in dessen Rahmen die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache eine wichtige Rolle einnimmt.[3] Ein dezidiertes Abgehen von einer bereits in weiten Teilen verwirklichten geschlechtergerechten Sprache widerspricht daher diesen Vorgaben.
Mit freundlichen Grüßen,
Wilfried Mayr, ÖLI-Vorsitzender
Josef Gary Fuchsbauer, ÖLI-Bundeskoordinator
24.3.2014